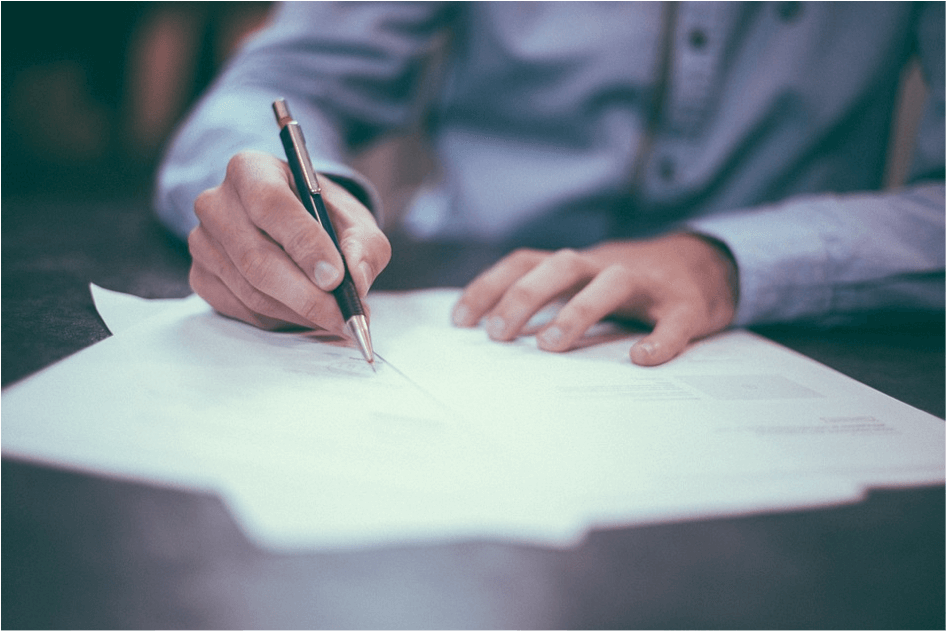
Bei den Werkverträgen handelt es sich um sogenannte privatrechtliche Verträge, die in den §§ 632 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches geregelt werden. Im Mittelpunkt eines Werkvertrages steht das gegenseitige Austauschverhältnis. Der Besteller, das ist in diesem Fall der Auftraggeber, erteilt dem Unternehmer, also dem Auftragnehmer, einen Auftrag zur Schaffung eines Werks. Ein Typisches Beispiel für einen Werkvertrag ist die Erstellung einer Webseite.
Es geht also vorwiegend um die Errichtung einer Sache – das ist auch der wesentliche Unterschied zum klassischen Dienstvertrag. Des Weiteren kann der Werkvertrag von beiden Seiten – also vom Besteller und vom Unternehmer – einseitig beendet werden, sofern ein Umstand vorliegt, der die Kündigung auch berechtigt.
Worauf der Besteller achten muss
Das Kündigungsrecht des Bestellers ist, verglichen mit dem Kündigungsrecht des Unternehmers, wesentlich weiter gefasst; zudem unterliegt das Kündigungsrecht des Bestellers keinerlei Einschränkungen. Der Besteller kann daher jederzeit, auch ohne Setzen einer Frist und auch ohne Angaben von Gründen, den Vertrag kündigen. Eine Kündigung ist sogar dann möglich, obwohl etwaige Mängel noch nicht beseitigt wurden. Zu beachten ist, dass der Besteller nur dann eine Kündigungsfrist einhalten muss, wenn es sich um fortlaufende Werkleistungen handelt. Ist das aber nicht der Fall, so muss der Besteller auch keine Kündigungsfrist berücksichtigen. In § 649 Bürgerliches Gesetzbuch wird zudem auch geregelt, dass dem Besteller ein eigenständiges Kündigungsrecht zusteht, das bis zur tatsächlichen Vollendung des Werks jederzeit ausgeübt werden kann. Somit wird auch eindeutig bestimmt, dass der Unternehmer auch keinen Anspruch auf die Abnahme des Werks hat, sondern nur einen Anspruch auf die im Vorfeld vereinbarte Vergütung. Es spielt somit keine Rolle, ob es zur tatsächlichen Erstellung des Werks kam oder nicht.
Welche Möglichkeiten stehen dem Unternehmer zur Verfügung?
Während die Kündigungsrechte des Bestellers wesentlich weiter gefasst sind, stehen dem Unternehmer nur geringe Möglichkeiten zur Verfügung, sofern er den Vertrag kündigen möchte. So kann er den Vertrag nur dann kündigen, wenn etwa ein wichtiger Grund vorliegt – so etwa, wenn die Vertragsfortsetzung unzumutbar geworden ist. Ist das der Fall, so kann der Vertrag gekündigt werden. Doch wann spricht man von einer Unzumutbarkeit? Etwa dann, wenn der Besteller – trotz einer Fristsetzung – den Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. Wurde das Werkvertragsverhältnis von Seiten des Unternehmers beendet, so muss dieser alle Leistungen, die bis zur Kündigung erbracht wurden, an den Besteller übergeben. Zudem kommt es auch zu einer Änderung der Zahlungsverpflichtung der im Vorfeld vereinbarten Vergütung. Aufgrund der Tatsache, dass dem Unternehmer keine finanziellen Vorteile aus der Werksvertragskündigung erwachsen dürfen, muss er ersparte Aufwendungen abziehen lassen (§ 649 Bürgerliches Gesetzbuch). Der Unternehmer braucht, nachdem er den Vertrag gekündigt hat, zudem auch keine weiteren Aufwendungen mehr zu tätigen, sodass es nicht zur Fertigstellung des Werks kommen braucht. Wurde der Vertrag gekündigt, so hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Höhe der Vergütung. Im Zuge der Berechnung muss der Unternehmer klar darlegen und auch beweisen können, wie es zur Vergütungshöhe gekommen ist. Im Gesetz findet sich hier eine sogenannte Vermutungsregelung, sodass der Unternehmer einen Anspruch auf 5 Prozent der Vergütung hat, obwohl er noch keine Werkleistung erbracht hat. Lag die im Vorfeld vereinbarte Vergütung bei 500 Euro, so darf der Unternehmer 25 Euro in Rechnung stellen.
Generalklauseln, die den Vergütungsanspruch begrenzen, sind unzulässig
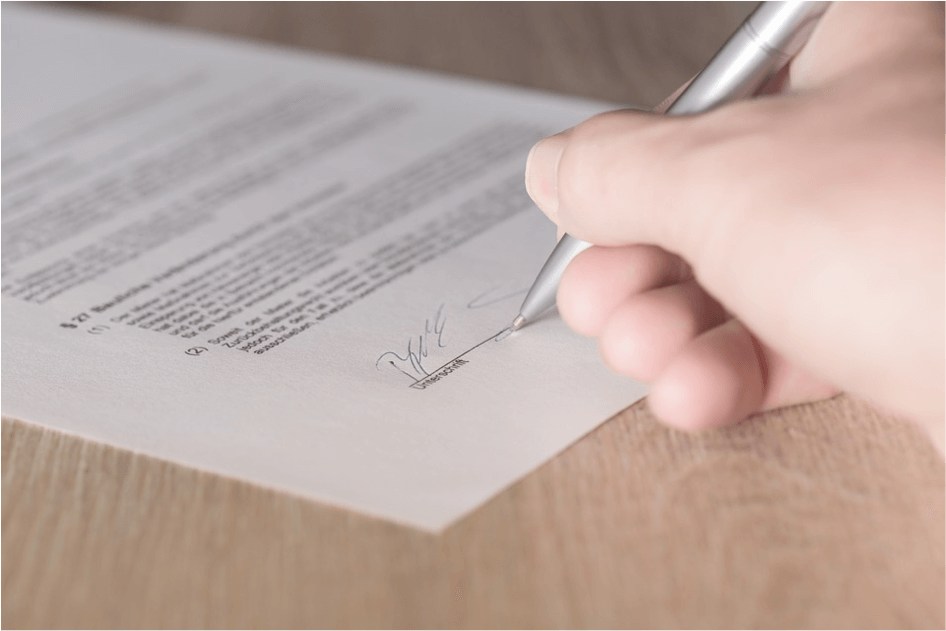
Natürlich versuchen die Auftraggeber immer wieder den Vergütungsanspruch der Unternehmer zu begrenzen, sofern es zur vorzeitigen Kündigung des Vertrages gekommen ist. Jedoch sind derartige Generalklauseln, die sich immer wieder in den Werkverträgen finden, nicht zulässig. Auch der Bundesgerichtshof hat sich bereits mit diesem Thema befasst und bestätigt, dass Generalklauseln, die den Vergütungsanspruch – in welcher Form auch immer – mindern, nicht rechtsgültig sind. Handelt es sich um ein „freies Kündigungsrecht“ des Auftraggebers, sofern besondere Umstände nicht gegeben sind, so ist die Kündigung nach Treu und Glauben nur dann gerechtfertigt, wenn der Unternehmer keine Nachteile erleiden muss.